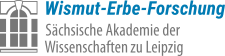Wismut-Erbe-Forschung
Die Freistaaten Sachsen und Thüringen beauftragten gemeinsam die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, multidisziplinäre Forschungen für das Wismut-Erbe zu sondieren, zu konzipieren und zu dokumentieren. Das Vorhaben lief vom 01. November 2019 bis zum 30. Juni 2021 in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Länderkunde und der Humboldt-Universität zu Berlin. In zwei Teilprojekten wurden schriftliche und mündliche Quellen in Archiven untersucht (Teilprojekt A) und Zeitzeugen (Teilprojekt B) befragt. Die Wismut GmbH begleitete und förderte das Projekt »Wismut-Erbe-Forschung«.
Übergeordnetes Ziel des Teilprojekts A war der Aufbau einer verlässlichen Infrastruktur über forschungsrelevante Themen sowie Art, Umfang und Zugänglichkeit von Materialien zum Wismut-Erbe. Als Materialien wurden dabei in Anlehnung an das Umsetzungskonzept des Deutschen Bergbau-Museums sowohl Archivgut (vgl. Wismut-Erbe im engeren Sinne) als auch Objekte, Landschaften und Überlieferungen durch Traditionsvereine (Wismut-Erbe im weiteren Sinne) aufgefasst. Da das strukturierte Aufarbeiten der „Wissensbestände zum Wismut-Erbe“ langfristig Ausgangspukte für eine themen- und problemorientierte Forschung schaffen sollte, ergaben sich aus diesem übergeordneten Projektziel folgende konkrete Ziele:
- Bestandsaufnahme und Zusammenführen der Ergebnisse in einem digitalen Forschungsportal, ohne dabei Doppelstrukturen zu Archiven und Sammlungen aufzubauen
- Inhaltliche und methodische Konzeptionierung einer Themenfindungskonferenz, um eine breite multidisziplinäre Forschung anzuregen
- Erarbeiten von exemplarischen Vorschlägen zur Vermittlung von Forschungsergebnissen an eine breite Öffentlichkeit, z. B. Schüler.
Um das angestrebte Ziel zu erreichen, wurde das digitale Forschungsportal »Wismut-Erbe« entwickelt. Es soll Wissenschaftlern und Öffentlichkeit gleichermaßen Zugang zur Forschung am Gegenstand Wismut ermöglichen. Aus den Archivbeständen als eher objektiven Zeugnissen mit Quellencharakter einerseits und dem Zeitzeugen-Fundus, also den subjektiven Zeugnissen andererseits, ergibt sich eine Forschungsinfrastruktur, die über die digitale Forschungsplattform sichtbar und zugänglich gemacht wird. Das Ziel des Forschungsportals ist daher die Darstellung und Recherchierbarkeit der erhobenen Datensätze zu Archivbeständen, verknüpften Personen-, Orts- und Ereignisdaten sowie des Stands der Forschung zum Wismut-Erbe. Die Darstellung der Zeitzeugen-Interviews erfordert dabei gesonderte Aufmerksamkeit, da diese sowohl als Video-Dateien als auch in Form von Transkripten präsentiert und miteinander verknüpft werden. Neben der Recherche von Archiv-, Literatur- und Interviewdaten dient das Forschungsportal auch der Information über das Wismut-Erbe (z. B. in Form von Einführungstexten etwa zur Literaturwissenschaft) sowie der Wissensvermittlung. Insgesamt wurden bis Projektende am 30.06.2021 fast 5000 Datensätze in die Datenbank eingepflegt, darunter befinden sich beispielsweise circa 750 Bestände, 2350 Quellen und mehr als 1000 Orte.
Die Datenaufnahme erfolgte in einem abgestimmten Workflow, der mehrfach an den Projektverlauf angepasst wurde. Die Datenstruktur ist dabei so flexibel wie möglich. Man kann Datensätze erweitern, sowie an- und abkoppeln. Die erhobenen Daten entsprechen den Grundsätzen der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit (FAIR-Data). Allgemein wurden für alle aufgenommenen Personen, Orte, Institutionen und Publikationen nationale und internationale Identifier (GND, VIAF, HOV) angelegt.
Doppelstrukturen wurden vermieden, indem auf bereits vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen wurde. So wurde beispielsweise, wenn möglich, auf die Sächsische Biografie verlinkt und konsequent die Identifier des Historischen Ortsverzeichnisses für Sachsen in die Datenbank eingearbeitet, um eine tiefere Recherche zu sächsischen Ortschaften zu ermöglichen.
Das Teilprojekt B rückte die bisher wenig beachteten Perspektiven der Menschen, die an der Geschichte der Wismut Anteil haben, ins Zentrum seiner Forschung. Die Vielseitigkeit und Stärke der Zeitzeugenbefragung als Quelle und Methode hat der Wismut-Geschichte dabei viel zu bieten, wurde aber bislang nicht ausreichend genutzt.
Das Zeitzeugenprojekt führte 50 narrative Zeitzeugeninterviews zum Wismut-Erbe. Mit der Sicht- und Hörbarmachung der biographischen Narration näherte man sich über Erinnerungen der Zeitzeugen sowohl an die komplexe Geschichte der „Wismut“, als auch an die Wismut als prägende Erfahrung an. Die Interviews nehmen die Anfangs- und Aufbaujahre, die Entwicklung des Bergbaubetriebes, die Auflösung der Wismut 1991 und die Wende- und Sanierungszeit seit Anfang der 1990er Jahre bis heute in den Blick. Weitere Themen sind u. a. das soziale und kulturelle Leben der „Wismut“, sowie die Auswirkungen des Uranbergbaus auf Natur, Umwelt und Gesundheit. Es wurden darüber hinaus Zeitzeugeninterviews aus anderen multimedialen Publikationen (Literatur, Dokumentarfilmen, Reportagen, Audioveröffentlichungen, etc.) in die Datenbank integriert und so der Forschung sowie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Projektlaufzeit: 01.11.2019 bis 30.06.2021
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektteam »Wismut-Erbe-Forschung« im September 2020.