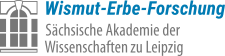Hilfe
Glossar
| Begriff | Erklärung |
| Abbau | (1) bezeichnet die Gewinnung von Bodenschätzen allgemein; (2) ist der Ort unter Tage, wo die Bodenschätze gewonnen werden [1] |
| Abraum | ist die Bezeichnung für die Deckmasse über einer *Erz-, Mineralien- oder einer Kohlelagerstätte [1] |
| Abwetter | bezeichnet die verbrauchte Luft unter Tage [1] |
| Aufbereitung | das geförderte Erzgestein liegt selten in reiner Form vor, sondern ist meist mit anderen Mineralien vermengt; vor der *Verhüttung musste es mittels der Vorgänge des *Röstens, des Schneidens von Hand, des Pochens im *Pochwerk und des Auswaschens in der *Wäsche von diesen getrennt werden [1] |
| Aufbereitungsanlage | dient zur Aufbereitung von Rohstoffen wie Wasser, Kohle, Erz sowie von Natursteinen, um sie in ihrer stofflichen Zusammensetzung und Beschaffenheit derart zu verändern, dass eine Weiterverwendung in der Industrie möglich ist |
| Aufwältigen | verbrochene *Grubenbaue werden wieder nutzbar gemacht, d. h. sie werden von hereingestürzten Gesteinsmassen und Wasser befreit [1] |
| Bergamt | untere Landesbehörde, die die behördliche Aufsicht über die Berwerke ausübt. Sie erstreckt sich auf Überwachung der Sicherheit der *Grubenbaue und des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter. Aufteilung der Bundesländer (Oberbergämter) in Bergamtsbeirke. [2] |
| Bergarbeiter | (= Bergleute, Bergmann, Kumpel) Sammelbezeichnung für alle Personen, die in einem *Bergwerk unter und über Tage beschäftigt sind [1] |
| Berggeschrey | Bezeichnung für den Zuzug von *Bergleuten nach Auffinden reicher *Erlagerstätten (z. B. 1491 am Schreckenberg), meist erfolgt danach die Gründung einer Bergstadt oder zumindest einer Bergbausiedlung [1] |
| Berg[bau]revier | (1) ist der Verwaltungsbezirk eines *Bergamts; (2) ist die Abteilung eines Grubenbetriebes bzw. die Region einer Bergbaulandschaft [1] |
| Bergfeste | (1) Schutzbereich im *Grubenfeld, in dem aus Rücksicht auf einzelne *Grubenbaue oder für Tagesanlagen nicht oder nur unter besonderen Bedingungen abgebaut werden darf (Schachtsicherheitsfeste); (2) In der *Lagerstätte in oder zwischen Abbauräumen stehenbleibender Lagerstättenteil, der den Zusammenhang des Gebirges gewährleistet, Bewegungen des Daches verhüten und damit den Abbauraum schützen soll [2] |
| Bergschaden | Beeinträchtigung der Tagesoberfläche mit dort befindlichen baulichen Anlagen durch Absenkung, Schiefstellung, Zerrung und Pressung infolge bergbaulicher Tätigkeit [2] |
| Bergwerk | umfaßt alle über- und untertägigen Einrichtungen (Gebäude, Anlagen, Maschinen, Geräte, *Grubenbaue), die dem Aufsuchen, Gewinnen, Fördern und Aufbereiten von Erz, Kohle, Salz und anderen mineralischen Rohstoffen dienen [2] |
| Bewetterung | Bezeichnung für die Be- und Entlüftung der *Grubenbaue [1] |
| Blaufarbenwerk | ist eine Produktionsstätte, wo aus Kobalterz der meist blaue Farbstoff gewonnen wird [1] |
| Blindschacht | ist ein untertägiger vertikal angelegter und nicht zu Tage führender *Grubenbau, der mehrere *Stolln und Strecken verbindet [1] |
| Brecher | maschinelle Zerkleinerungsanlage, um die für den Betriebszweck erforderlichen Korngrößen von Kohle, Erzen, Salzen und anderen Gesteinen herzustellen [2] |
| Deckgebirge | ist die Gesamtheit aller Schichten, welche über den nutzbaren *Lagerstätten liegen [1] |
| Erz | allgemeine Bezeichnung für das Mineralgemenge, aus dem sich Metalle gewinnen lassen [1] |
| Erzlagerstätte | sind natürliche, lokale Anreicherungen von *Mineralen oder Mineralgemengen in der Erdkruste oder an der Erdoberfläche, die wirtschaftlich nutzbar abegebaut werden können |
| Exploration | ist die Bezeichnung für die Suche oder für die Erschließung von *Lagerstätten (1) |
| Flöß (Floß/Floßgraben) | ist ein meist künstlich angelegter Graben, welcher dem Transport von Holz dient |
| Flöz | bergmännische Bezeichnung für die Anhäufung sedimentär entstandener, nutzbarer *Mineralien oder Kohle in Form einer Schicht, die im Verhältnis zu ihrer Mächtigkeit eine große Länge und Breite aufweist und von fast parallelen Flächen begrenzt ist [2] |
| Fördergestell | ist eine aus dem *Förderkorb entstandene Vorrichtung, nimmt im *Schacht die *Bergleute zur Ein- und Ausfahrt sowie die *Hunte zum Transport auf [1] |
| Förderkorb | ist ein aus dem historischen Bergbau stammender und noch heute gültiger Begriff, womit ein Fördergefäß (Kübel, Tonne) im *Schacht gemeint ist (*Fördergestell) [1] |
| Fördern | Fortbewegen von Haufwerk, Materialien und Lasten aller Art [2] |
| Förderturm | Bezeichnung für ein turmartiges hölzernes oder gemauertes Gebäude über dem *Schacht (auch Treibehaus genannt), in diesem Turm befindet sich die *Seilscheibe und die Förderantriebsmaschine [1] |
| Gang | mit *Erzen oder anderen *Mineralien ausgefüllte, meist steil einfallende Kluft, die das Nebengestein unter beliebigen Winkeln durchsetzt [2] |
| Gebirge | ist das den *Bergmann unter Tage umgebende Gestein [1] |
| Gewinnung | ist die Bezeichnung für das Lösen nutzbarer *Erze, Minerale oder Kohle aus dem Gesteinsverbund [1] |
| Gezähe | ist die bergmännische Sammelbezeichnung für das gesamte Werkzeug der *Bergleute [1] |
| Grube | der untertägige Bereich eines Bergwerks; in einigen *Bergbaurevieren dem Begriff *Bergwerk oder *Zeche gleichgesetzt; im Tagebau bezeichnet Grube den Abbaubetrieb [2] |
| Grubenbau | ist ein planmäßig geschaffener bergbaulicher Hohlraum [1] |
| Grubenfeld | Raum unterhalb der Erdoberfläche, in dem der Bergbauberechtigte sich Lagerstätteninhalte aneignen darf [2] |
| Grubenwehr | Gruppe von Belegschaftsmitgliedern mit Spezialausbildung für die Rettung von Menschen, für die Grubenbrandbekämpfung und für Arbeiten in schädlichen Gasen [2] |
| Halde | ist die übertägige Anhäufung des aus dem *Grubenbau geförderten *tauben Gesteins [1] |
| Hauer (Häuer) | ist ein in den *Gängen mit dem *Gezähe arbeitender *Bergmann, er besitzt eine bergbauliche Ausbildung und Erfahrung [1] |
| Hauen | Bezeichnung für das Lösen des Gesteins mit scharfen *Gezähe [1] |
| Haufwerk | ist das durch die bergmännische Arbeit aus dem *Gebirge gelöste Gestein [1] |
| Hunt(e) | Bezeichnung für einen kleinen vierrädrigen Förderwagen, der dem Transport unter Tage dient, und der vom *Stößer geschoben wird [1] |
| Hütte | eine Produktionsstätte, wo *Erze und *Mineralien geschmolzen werden [1] |
| Lagerstätte | Bezeichnung für das Vorhandensein abbauwürdiger *Erze und *Mineralien [1] |
| Lichtloch | (1) ist ein kleiner *Schacht für die *Bewetterung; (2) ist der Ansatzpunkt beim Vortrieb eines *Stollns im Gegenortbetrieb [1] |
| Lore | (1) ist ein Wagen für den Transport von Schüttgut, z. B. *Abraum, er läuft auf Schienen und besitzt im Gegensatz zum *Hunt eine Kippmulde; (2) ist ein Gewichtsmaß für den Erztransport, 1 Lore = 90,00 kg [1] |
| Markscheide | ist eine bergbauliche Bezeichnung für die Grenze einer *Fundgrube [1] |
| Mineral | chemisch und physikalisch einheitlicher Naturkörper, Bestandteil der festen Erdkruste, der sich häufig durch eine gesetzmäßig gebildete Form (Kristallform) auszeichnet [2] |
| Mundloch | Bezeichnung für einen meist gemauerten, bogenförmig ausgelegten, horizontalen Tagesausgang bzw. Eingang zu einem *Stolln [1] |
| Objekt | ist ein mit Nummer versehener Bergbaubetrieb der "Wismut" |
| Pechblende | eine alte Bezeichnung für kompaktes Uranerz [1] |
| Pochwerk | ist eine mit Wasserkraft betriebene Anlage zum Zerkleinern der *Erze und des *tauben Gesteins zu einem feinkörnigen Gemisch mittels der Pochstempel; im Jahr 1507 führte Sigismund von Maltitz (1464-1520) in Dippoldiswalde das Nasspochverfahren ein, das Erzgestein wird während des Pochvorgangs mit Wasser umspült, was letztlich zur Staubbindung und zur Verringerung von Erzverlusten führte [1] |
| Rösten | bezeichnet das Glühen von *Erz, um Bestandteile wie Arsen oder Schwefel auszutreiben [1] |
| Saiger / Seiger | bezeichnet einen senkrecht (vertikal) einfallenden *Gang mit einem Winkel zwischen 75° und 90° [1] |
| Schacht | lotrechter *Grubenbau, mit dem eine *Lagerstätte von der Tagesoberfläche aus erschlossen wird; nach dem überwiegenden Verwendungszweck unterscheidet man Förder-, Wetter-, Seilfahrt-, und Materialschacht; bei gleichmäßigem steilen Einfallen der Gebirgsschichten kann ein Schacht auch tonnlägig als Schrägschacht hergestellt werden [2] |
| Schachtanlage | Teil eines *Bergwerks, das infolge der Größe seines *Grubenfeldes in mehrere räumlich voneinander getrennte Schachtanlagen aufgeteilt ist; die Außenschachtanlagen erfüllen oft nur spezielle Aufgaben (zum Beispiel Seilfahrt, Wetterführung, Materialtransport) und verfügen dann nicht über alle Einrichtungen einer Hauptschachtanlage; in manchen Fällen sind Schachtanlagen und Bergwerk gleichbedeutend [2] |
| Schicht | (1) Bergmännischer Zeitbegriff für einen Zeitraum von 8 Stunden; (2) Geologischer Ausdruck für durch Trennflächen (Lösen) unterteilte Ablagerungen von Sedimentgestein [2] |
| Seilscheibe (Treibscheibe) | ist ein Rillenrad im *Förderturm, über welches das von der Fördermaschine kommende Förderseil zum *Förderkorb läuft [1] |
| Sohle | waagerecht bzw. horizontal, bezeichnet den unteren Bereich eines *Grubenbaus [1] |
| Steiger | ist ein Bergbeamter und Vorgesetzter im Bergbau bzw. eine Aufsichtsperson mit besonderer bergmännischer Qualifikation; der Steiger leitet arbeitsorganisatorisch, markscheiderisch und abrechnungstechnisch eine *Zeche; er hat sich bereits vor Beginn der *Schicht einzufinden, die Arbeit der *Bergleute einzuteilen, den Arbeitsschutz, das Werkzeug und die Schutzkleidung zu kontrollieren [1] |
| Stolln (Stollen) | ist ein horizontal getriebener *Grubenbau mit *Mundloch zur Entwässerung, sowie zur Erkundung, zum *Abbau, zur *Bewetterung und zum Fahren [1] |
| Stößer | ist ein Transportarbeiter unter Tage, der die *Hunte schiebt [1] |
| Strecke | ist ein horizontal aufgefahrener *Grubenbau in oder außerhalb einer *Lagerstätte; im Gegensatz zum *Stolln verfügen Strecken über kein *Mundloch, sondern münden in einen Schacht [1] |
| Taubes Gestein | ist Gestein ohne Erzgehalt [1] |
| Teufe | bezeichnet das Maß bzw. die Tiefe eines *Schachtes [1] |
| Teufen / Abteufen | Bezeichnung für das Niederbringen eines *Schachtes [1] |
| Verhüttung | Prozess zur Gewinnung von Metall und anderen Rohmaterialien |
| Wäsche | ist eine Anlage zur *Aufbereitung von *Erz- und Mineralgemengen mit Wasser und / oder Schlamm; die Aufbereitung erfolgt in drei Geställen (Haupt-, Mittel-, und Sumpfschlamm), d. h. durch Schüren und Pochen erfolgt die Trennung des Erzes vom *tauben Gestein; die als Wäscher bezeichneten Arbeiter sind gleichfalls für die Reinigung des Wassers bzw. Waschschlamms verantwortlich [1] |
| Wetter | Bezeichnung für die Luft im *Grubenbau; gute Wetter = sauerstoffreich / matte Wetter = sauerstoffarm / böse Wetter = mit giftigen Gasen angereichert / Schlagwetter = mit explosiven Gasen (Methan) angereichert [1] |
| Wetterführung | sind notwendige Maßnahmen zur Versorgung der *Grubenbaue mit Frischluft und zur Entsorgung der verbrauchten Luft [1] |
| Wetterschacht | ist ein der *Bewetterung dienender *Schacht, der meistens mit einem Ventilator für ausziehende *Wetter versehen ist [1] |
| Zeche | (1) Bezeichnung für den gesamten Bergbaubetrieb; (2) in einigen Regionen die Bezeichnung für ein Kohlebergwerk [1] |
| Zinnstein (SnO2) | Bezeichnung für feinkörnige, durch die Wirkung von Wasser aus Klüften und *Gängen losgelöste Zinnablagerungen (Kassiterit) [1] |
Quelle:
- Herschel, Klaus-Peter: Kleines Bergbau-Lexikon. Ältere und neuere Begriffe sowie Gewichte, Maße, Ämter und Funktionen im Berg- und Hüttenwesen, Annaberg-Buchholz 2020.
- Bischoff, Walter: Das kleine Bergbaulexikon. 4., neu bearb. u. erw. Aufl... Essen, 1983.